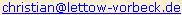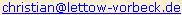In der späten Vespersonne
Klappentext
Heute wieder wie in seiner Jugend zum Wanderjäger geworden, berichtet Lettow-Vorbeck in diesem die Trilogie seiner "Grünen Bücher" abschließenden Band von vier markanten Begegnungen der letztvergangenen Jahre, von denen eines zugleich zum unvorhergesehenen Höhepunkt seines ganzen Lebens als Jäger geworden ist.
Er erzählt von einer Jagdfahrt auf den roten Bock in Polen mit dem Hintergrund versöhnender und herzlicher Gastlichkeit, wie sie überall in der Welt und unabhängig von allen Zeitumständen echte Jäger immer miteinander verbindet, und von dem unerwarteten Wiedersehen mit seiner alten Heimat, das ein Gefühl tiefer Beglückung über die Unzerstörbarkeit von Landschaft und Erinnerung hinterläßt.
Der zweite Erlebniskreis umfaßt in drei aufeinanderfolgenden Jahren die Hirschbrunft in Zentralspanien in sonnenüberfluteten, menschenleeren Weiten aus Stein und Strauch, in denen sich die hohe Zeit des Rotwildes noch am hellichten Tage abspielt.
Das dritte große Ereignis wird zur Erfüllung eines Jugendtraumes, eine Jagdfahrt nach Kanada mit der Erlegung eines Bergcaribou und eines Elches von Weltklasse.
Die vierte Reise führt in den schwarzen Erdteil und erneut nach Momella am Fuße des Meru zur Familie Trappe und dem ungarischen Jagdfreund von Nagy, dem ersten Pächter eines Jagdrevieres in Ostafrika. Sein Waidwerken in den geheimnisvollen Regenurwäldern hat nichts mit den üblichen Safarijagden zu tun, sondern ähnelt mehr dem Jagen in den Karpaten mit Pürsch und Ansitz inmitten der tropischen Landschaft und Tierwelt. Das Schlußkapitel führt noch einmal im Rückblick in die ehemalige Heimat zu einer schicksalumwitterten alten Fischerkate unter uralten Baumriesen, an der mehr als ein Pürschgang vorüberführte, und deren Untergang in den Flammen des Krieges zum gespenstigen Symbol der Zeit wurde.
In seiner menschlichen Weite und in der Meisterschaft der Sprache gehört dieses Buch zum Reifsten, was Lettow-Vorbeck je geschrieben hat.
VORWORT
Spätvespersonne - jeder Jäger weiß um ihren eigenartigen Zauber, wenn ein langer Arbeitstag zur Neige geht, der abendliche Friede sich auszubreiten beginnt und auch in unserem Gemüt die Unrast einer friedvollen Besinnlichkeit weicht. Jene goldgrüne Stunde, die uns in mildem Licht die Landschaft und das vielgestaltige Leben, alle Farben und Formen, Großes wie Geringes in seltener Klarheit erkennen läßt, erweckt eine besondere Stimmung, die erwartungsfroh zu stillem Waidwerk hinauslockt.
Mit der Sonne im Rücken und die von ihrem Schein überglänzten Räume und Zeiten vor Augen, ist dieses Buch geschrieben. Es schildert Pürschen und Reisen in nahe und ferne Länder, denn nach dem Verlust der Heimat bin ich - wie zu Beginn meines Jägerlebens - wieder zum Wanderjäger geworden. Überall, wo Wälder rauschen, Wild seine Fährte zieht und die Stille nur durch Laute und Lieder der Schöpfung durchbrochen wird, ist der Jäger daheim. Anfang und Ende dieses Buches aber - wie könnte es anders sein - sind zeitlos in ihrem Gehalt dem versunkenen Paradies der pommerschen Heimat gewidmet. Wie dort Jagd und Landwirtschaft untrennbar miteinander verbunden waren, so kreisen diese Erinnerungen nicht nur um das jagdliche Geschehen, sondern schließen auch das ländliche Leben und das Zusammenleben mit den Menschen auf der heimatlichen Scholle mit ein - überstrahlt auch dies von der Spätvespersonne einer immer tiefer bewußt werdenden Dankbarkeit, daß dieses Elysium einmal der eigene Lebensbereich sein durfte.
Bücher sind Freunde und schaffen Freunde. Die "Grüne Passion" und die "Grünen Blätter" haben das in reichem Maße erwiesen. Solche kostbaren Freundschaften zu erhalten, wenn möglich zu vermehren und meinen Dank allen getreuen Weggefährten abzustatten, erwog und ermutigte mich dazu, ein drittes und abschließendes grünes Buch vorzulegen.
ERSTES KAPITEL
NACH OSTLAND WOHL ÜBER DIE HEID
Was Großgrundbesitz im deutschen Osten in den Augen des alteingesessenen Eigentümers bedeutete, zeigt ganz treffend folgende kleine Geschichte, die von einem bekannten ostpreußischen Magnaten erzählt wird: Nach einem langen arbeitsamen Leben lag er auf seinem Sterbebett und schaute verdrossen drein. Seine Gattin, in Erwartung der zum Abschied herbeieilenden nächsten Angehörigen, wünschte sich einen anderen Ausdruck im Antlitz des Scheidenden und sprach ihm gut zu. Für einen Christenmenschen sei es doch auch eine große Freude, dies Jammertal hinter sich lassen zu können und nun vor den Toren des Paradieses zu stehen. Recht verstanden sei es doch nur ein Gewinn. "Jammertal?" wiederholte fragend der Sterbende, und während sein Blick aus dem Fenster hinaus und durch eine Lichtung des Parkes über die grünen Fohlenkoppeln hinweg bis zu dem in der Ferne blinkenden See herüberschweifte, nörgelte er: "Das ist es ja gerade, daß sich unsereiner drüben nicht verbessern kann!"
Großgrundbesitz nicht nur, sondern auch den kleinen Hof im alten deutschen Osten wird wohl jeder, der solchen Heimathorst je besaß und dann verlor, als ein irdisches Paradies betrachten. Freilich auch ohne Vertreibung nur als ein Paradies auf Zeit, denn im Wechsel der Generationen reichen Abschied und Willkomm einander die Hände, ist auch der Eintritt ins irdische Paradies für den Nachfolger kein strahlendes Glück, sondern meistens umschattet vom Tode des Vorgängers. Jene Tage tiefgreifendster, innerlicher Spannungen, da auch ich an der Bahre des geliebten Vaters trauerte und zugleich die Schwelle höchster Lebenserfüllung überschritt, haben sich mir unvergeßlich ins Gedächtnis eingeprägt. -
Draußen leuchtete die blasse Januarsonne über der leicht verschneiten Landschaft. Es war um die Mittagsstunde, und trotz der Doppelfenster schwang von Roggow herüber das volle Trauergeläut in die stille Stube, wie schon seit vier Tagen, und noch zehn weitere Tage würden die Glocken läuten, wie es dem heimgegangenen Kirchenpatron gebührte. Ich aber saß zum ersten Male an dem verwaisten Schreibtisch, nun das Notwendige zu tun, die Arbeit dort aufzunehmen, wo der unerwartet jähe Herztod meines Vaters sie unterbrochen hatte. Was mich im einzelnen erwarten würde, wußte ich nicht, denn es hatte nicht einmal die Ahnung eines Abschiedes gegeben, als ich meinen Vater zum letzten Male sah. Trotzdem hatte ich die Sekretärin nicht zu mir gebeten, weil ich allein die letzte Korrespondenz sichten und einen letzten Liebesdienst darin suchen wollte, so zu handeln und zu entscheiden, wie es dem Willen und Wunsch des Verschiedenen entsprechen würde.
Doch ich saß vor dem Schreibtisch wie vor einem Heiligenschrein, und jede Berührung schien mir fast wie eine Entweihung. Seit Kindheitsgedenken hatte sich hier nichts gewandelt. Wie eh und je drehte sich der messingblanke Kreiselpendel der Jahresuhr unter dem Glassturz, grüßten die Bilder und Kleinbronzen und alle die Kleinigkeiten, an denen meines Vaters Herz gehangen hatte. Beherrscht aber wurde dies alles durch das Großphoto meines Bruders, gerahmt in der karmesinroten Farbe der Königinkürassiere. Und zwischen Glas und Rahmen in der geliebten Handschrift meiner Mutter der Bibelspruch: "Ich lebe und ihr sollt auch leben!" Zweimal war die Erbfolge unterbrochen worden, hatte der Krieg den Großvater und seinen Enkel in der Jugend dahingerafft, bevor sie das "irdische Paradies" betreten durften.
Ich trat ans Fenster. Hinter der weiß verschneiten Wiese auf dem Hügel über dem Ückleytal unter den winterkahlen Buchenriesen schimmerten die Marmorkreuze durchs Unterholz. Bald würde eines mehr errichtet werden.
Lange fesselte mich dieser Blick, diese fast alltägliche Brücke zwischen Zeit und Ewigkeit, dann machte ich mich ans Werk, öffnete die braune Preßledermappe und las die letzten Briefe, die den Lebenden erreicht hatten. Sie waren zumeist geschäftlicher Art oder betrafen die künftige Frühjahrsbestellung. Doch zwischen ihnen fand ich einen Zeitungsausschnitt und wunderte mich sehr, denn es war nicht meines Vaters Art, dergleichen aufzuheben. Es war ein Gedicht, dessen Verfasser mir inzwischen entfallen ist. Hierin verglich der Dichter sein Landgut zunächst mit der Mutter, die ihn die ersten Schritte ins Leben lehrte, dann mit der Schwester, der Gefährtin und Gespielin der Jugend und dann mit der Braut, die er sich inbrünstig werbend zur Frau erkor. Nur noch die letzten Verse sind mir heute geläufig:
"Sah in deinem Besitz irdische Seligkeit
Schmückte dich gern und schuf dir ein reicheres Kleid.
Schöner und jünger wurd'st du von Jahr zu Jahr.
Mir aber weben schon silberne Fäden im Haar.
Wie eine Tochter schau ich voll Wehmut dich schon, Denkend der Stunde, da Abschied mein Lohn,
Da ein Stärkerer kommt, für den du bestimmt Und mit Herrschergefühl in die Arme dich nimmt!"
Damals las ich diese Verse wieder und wieder und in steigender Erregung. Es schnürte mir die Kehle zu, denn ich empfand, daß dies ein persönliches Vermächtnis meines Vaters für mich, Botschaft und Befehl aus dem Jenseits war. Ich sprach die Verse laut vor mich hin, während ich in dem saalgroßen Zimmer auf und nieder schritt. An den Wänden die sieben großen Kupferstiche, die Alexanderschlachten darstellend, auf Befehl Ludwig XIV. für seine Günstlinge gestochen, auf unbekannte Weise nach Hoffelde geraten, unter vergilbender Wachsschicht auf dem Dachboden aufgefunden und vom Berliner Kupferstichkabinett glänzend restauriert. In der Ecke hinter dem Diwan mit seiner Decke aus achtzehn Fuchsbälgen der goldglänzende Küraß, umstanden von Degen und Pallaschen, an der Wand über dem großen Sofa die Rehkronen, bescheidene Lebensernte eines bodenständigen Jägers, und hier in der Wohnecke, wo sich Abend für Abend die ganze Familie versammelte, unter der grünen Leselampe am Ofen der nun für immer verwaiste Sessel des Hausherrn. Ich nahm dies alles noch einmal abschiednehmend in mich auf, dann riß ich mich aus dem Reich der Toten und stürzte mich in das der Lebenden. Die Mutter und Schwester war mir zur heimgeführten Braut geworden, und ich sah in ihrem Besitz - irdische Seligkeit! -
Daß die liebe Landwirtschaft mit einem Mindestmaß an Begabung und Intelligenz zu bewältigen sei, war damals eine weitverbreitete Meinung in urbanen Kreisen und ist es wahrscheinlich auch jetzt noch. Zumindest damals, als die Höfe noch nicht wie heute zu größtmöglicher Rationalisierung, Mechanisierung und Spezialisierung auf einige wenige Zweige gezwungen waren, gab es indessen kaum einen Beruf, der vielseitiger war als der des Leiters eines großen landwirtschaftlichen Betriebes. Im Gegensatz zur Gegenwart galt damals als gesundes Grundprinzip, "auf vielen Beinen zu stehen", alle möglichen Zweige des Ackerbaues, der Viehzucht und der die eigenen Erzeugnisse veredelnden Industrie zu pflegen oder anzusiedeln, um alle Konjunkturschwankungen sicher zu überdauern. Kaufmännische Fähigkeiten waren schon seinerzeit fast ebenso wichtig wie fachlich-sachliche Kenntnisse. Lohnende Viehhaltung zwang zur Beschäftigung mit biologischen, züchterischen und veterinärmedizinischen Fragen, der hochintensive Ackerbau durch künstliche Düngung und Bodenanalysen zu solcher auf dem Gebiet der Chemie, die bereits mächtig aufkommende Mechanisierung zu technischer Fortbildung, und der alltägliche Ablauf erforderte eine dauernde betriebswirtschaftliche Überwachung. Die Landwirtschaft war ja zugleich ein ungeheures Transportunternehmen, in dem die gesamte Erzeugung mehrfach bewegt, die riesigen Massen an Halmfrucht und Heu z. B. zu Hof und Scheune hinein und umgewandelt zu garem Dung wieder aufs Feld zurückgeschafft werden mußten. Die Unterhaltung der vielen Gebäude, die Erstellung neuer schuf ständige Verbindung zum Bauwesen. Von der Wasserwirtschaft waren Kenntnisse erforderlich und zumeist desgleichen von der Forstwirtschaft, und alles war im Fluß der Weiterentwicklung, schon Stillstand bedeutete Rückschritt, und so hieß es immerfort lernen, lernen, lernen.
Das wertvollste Kapital aber, das man zu verwalten oder - besser gesagt - zu betreuen hatte, waren die Menschen, insonderheit der Stamm der alteingesessenen Landarbeiterfamilien. Ihnen bedeutete der Betrieb nicht nur Arbeitsplatz, sondern Heimat im allumfassenden, herznahen Sinn dieses Wortes. Durch lange Geschlechterfolgen waren sie mit Leib und Seele der Scholle verhaftet. Häufig hinterließ der Vater dem Sohn sein Amt, sein Gespann, seine lebenslang gehütete Herde, namentlich unter den Dienern, Kutschern, Förstern und Gärtnern entwickelten sich auf diese Weise ganze "Dynastien". Nicht nur der Mann, die gesamte Familie war in den Betrieb mit einbezogen, nach der Konfirmation traten die Kinder in der Regel als Hofgänger ein, und die Frauen halfen fleißig zur Erntezeit. Ihre Tüchtigkeit und ihr Arbeitswille standen denen der Männer keineswegs nach, und sie waren es eigentlich, die den Grad des Wohlstandes der Familie bestimmten. Dem verhältnismäßig recht bescheidenen Barlohn stand ein reichlich bemessenes Deputat gegenüber, und ihrem Fleiß und Geschick oblag es, aus Kuh- und Schafhaltung, Schweinemast, Gänseherde und Kleingeflügelaufzucht klingende Münze herauszuwirtschaften. So hatten sie nicht selten mehr mitzureden als die Männer, und wehe dem Gutsherrn oder Inspektor, der es mit ihnen verdarb. Wo wäre die westdeutsche Landwirtschaft nach dem Kriege hingeraten, wenn ihr nicht im Strom der Flüchtlinge und Heimatvertriebenen diese unübertrefflichen Arbeitskräfte zugeflossen wären! Nicht lange und überall auf den Gütern und Höfen besetzten die Pommern und Ostpreußen die wichtigsten und vertrauenswürdigsten Posten.
Wie bei den meisten lange Zeit im Familienbesitz befindlichen Gütern gab es auch bei uns nur wenige "Zugvögel", die sich alle paar Jahre mit Kind und Kegel, Sack und Pack "veränderten". Die meisten waren, wie sie mit Stolz zu sagen pflegten, in Hoffelde "geboren und gezogen", und die Alten hatten schon unter meinem Urgroßvater gedient. Es war eine zutiefst im Heimatboden verwurzelte Gemeinschaft, in der jeder jeden kannte mit allen seinen Eigenarten, Vorzügen und Schwächen, mit dem Schicksal, das er zu tragen, und den Sorgen, mit denen er sich herumzuschlagen hatte, eine Gemeinschaft, der angehört zu haben und in der geborgen gewesen zu sein, noch heute einen der wesentlichsten und kostbarsten Inhalte meines Lebens bedeutet. Sie hat auch dann, als sie in alle Winde verstreut wurde, beständig zu bleiben nicht aufgehört, vornehmlich die viele Post von drüben beweist es und erst recht die Seligkeit des Wiedersehens bei den sich nun mehrenden Rentnerbesuchen!
Was in Gestalt der Beamten, Angestellten und Arbeiterschaft die menschliche Basis betraf, war ich damals also aufs beste versorgt und konnte der getreuen Unterstützung durch jedermann gewiß sein. Doch es war kein leichtes Erbe, das ich antrat, denn die sogenannten "golden zwanziger Jahre" waren für die Landwirtschaft recht schwarze gewesen. Mein Vater hatte mit eiserner Sparsamkeit gewirtschaftet und jeweils nur das angeschafft, was in bar bezahlt werden konnte, und das war nicht eben viel gewesen. Lebenswichtige Investitionen mußten unterbleiben, und wenn damit auch die Gefahr der Verschuldung vermieden wurde, so war nun doch der Zeitpunkt eingetreten, an dem große Aufwendungen für das lebende und tote Inventar nicht weiter aufgeschoben werden konnten. Vor mir schien ein sehr weiter und mühevoller Weg zu liegen, bis das Fernziel einer Wiedergesundung des Betriebes erreicht werden konnte. Dann aber kam mir eine fruchtschwere Zeit zur Hilfe. Es galt damals, das Millionenheer der Arbeitslosen wieder in Lohn und Brot zurückzuführen, und Arbeitsbeschaffung in jeder nur denkbaren Form wurde vom Staat durch billige Kredite und erhebliche Zuschüsse, ja, selbst durch Niederschlagung von Steuerschulden honoriert. Arbeitsdienst, damals noch freiwilliger, rückte an, Hunderte von Hektar versumpfter und versauerter Rieselwiesen wurden in wertvollstes Grünland verwandelt, der Viehbestand beträchtlich vermehrt und verbessert, und wo einst der Futteranbau auf dem Feld getätigt werden mußte, wuchsen nun marktfähige Früchte, zumeist in Form von Saatgut und Hochzuchten. Die Spiritus- und Kartoffelflockenfabriken liefen auf vollen Touren. Ein Heer von Handwerkern rückte an, die seit Jahrzehnten zwangsläufig unterbliebenen Instandsetzungsarbeiten an den vielen Betriebsgebäuden und Arbeiterwohnungen nachzuholen. Moderne Maschinen und Motoren machten eigene Arbeitskräfte frei, die nun neue und außerplanmäßige Vorhaben in Angriff zu nehmen vermochten. Es gab kaum noch einen Winkel, in dem nicht gegraben, gehämmert, geschafft und geschuftet wurde. Und immer sichtbarer erfüllte sich jene Verszeile: "Schöner und jünger würd'st du von Jahr zu Jahr!"
Die allmonatlich gewissenhaft aufgestellten Bilanzen und Voranschläge - in den Anfangsjahren Anlaß zu Sorgen und schlaflosen Nächten -stellten sich immer günstiger und erlaubten immer kühnere Pläne, auch solche, die keinen schnellen Gewinn versprachen oder gar überhaupt nicht mehr betriebswirtschaftlicher Art waren, sondern Erfüllung traumhafter Vorstellungen. Hier vor allem das Pflanzen von Bäumen. Ein hoch und dicht bestandener Raps- oder Weizenschlag, ein unkrautfreies Hackfruchtfeld erfreut unser Auge einen Sommer lang, mit jedem Baum aber, den wir setzen, wächst unsere Freude von Jahr zu Jahr, und hierfür bot sich mir Gelegenheit über alle Erwartung hinaus.
Die überreich fruchtenden Kunstwiesen machten manche abgelegenen dürftigen oder sauren Hütungen überflüssig, das auch in der Landwirtschaft machtvoll einsetzende Maschinenzeitalter zwang zur Begradigung der Felder und damit zur Abtrennung vorbuchtender oder einkehlender und auch steil hängiger Ackerflächen, die nun bedenkenlos der Waldfläche zugeschlagen werden konnten. Jede Bodenart war verfügbar und erlaubte das künftige Waldbild bunt zu gestalten. Pappeln und Erlen, Douglasien und Lärchen, die mir in Ostpreußen als Waldbaum liebgewordene Linde und viele andere fanden ihren standortgerechten Platz. Große Pflanzgärten wurden angelegt und zwangen mit ihrem Oberschuß auch später, als alle Großflächen kultiviert waren, auf jedem Ritt und jedem Gang nach Plätzen zu fahnden, wo noch die eine oder andere Gruppe, der eine oder andere gemischte Horst untergebracht werden konnte. Und mehr und mehr erfüllte sich auch jene andere Verszeile: "Schmückte dich gern und schuf dir ein reicheres Kleid!"
Natürlich pulste hinter allen forstlichen Planungen das Jägerherz. Ein Teil der verfügbaren Flächen wurde zu Wildäckern, die breit angelegten Schneisen wurden mit Klee und Süßgräsern zur stillen, ungestörten Mittagsäsung angesät, wo das Laubholz überwog durch kleine Nadelhorste warme "Winterstuben" für das Schalenwild geschaffen und in den Feldgehölzen dornstrauchumwehrte, Raubwild und Raubzeug abhaltende Dauerdickungen für Has', Huhn und Fasan erstellt. Der Stellmachermeister schuf offene, doch durch rohrgedeckte Runddächer geschützte Hochsitze und ebenso überdachte Wildfütterungen, viele von ihnen durch Schlittenkufen beweglich gemacht, um der Bodenverseuchung durch ausgeschiedene Parasiten zu begegnen. Das Netz der Pürschpfade und der mit Schlag- und Kastenfallen bestückten Fangsteige wuchs von Jahr zu Jahr, desgleichen die Zahl der in Wald und Feld aufgehängten Kunstnisthöhlen aller Kaliber. Gar nicht selten geschah es, daß ich für den Pürsch- oder Reviergang die Patronen einzustecken vergaß, aber das Gehänge mit Baumsäge, Rosenschere und anderen Utensilien, die man braucht, um Baumkindern Licht und Luft und die gewünschte Form zu verschaffen, vergaß ich nie.
Fruchtbare Sommer folgten einander und brachten reiche Ernten, der Wohlstand wuchs, und nun konnte ich Zug um Zug den Wunschtraum, der schon den Knaben gefesselt, verwirklichen. Es entstand das Wildgatter mit Ungarhirsch und Rominter Kahlwild, mit dem Holsteiner Schaufler und den Damtieren aus der berühmten Nymphenburger Linie, mit dem Muffelwild rein korsikanischen Blutes und solchen bayerischer Herkunft, mit dem Kapitalbock aus Rumänien und seinem pommerschen Harem, mit Königsfasan und Kranich und dem bunten Volk vieler einheimischen Wildenten auf den beiden künstlich aufgestauten, mit Schleien und Karpfen besetzten Teichen. Was sich hier abspielte an Erfolg und Mißlingen, an Freud' und Leid, Idyllen und Tragödien habe ich in meinem Buch "Grüne Passion" ausführlich geschildert.
Dam- und Muffelwild haben dann von dort aus als Neubürger auch das freie Revier bevölkert und eine ihm gemäße Heimat gefunden, aber Haupt- und Herzwild blieben immer die Rehe.
Es war ja nicht, wie zumeist hier im Westen, wo die Begegnung mit dem Wildgetier zu Erholung und "Hobby" des Wochenendes geworden. Saß man daheim sommers vespernd auf der Veranda, hatte man schon des lieben Anblicks die Fülle: Den Himmel voller Schwalben, in Linden und Akazien den unermüdlich schmetternden Gelbspötter und den ewig schwätzenden Laubsänger, über den Blumenbeeten und den Randstreifen der brennendroten Salvien rüttelnd in der Luft den Fliegenschnäpper und das Gartenrotschwänzchen in seiner schwarzblau und goldroten Pracht, den Buchfink im Prunus, den Grünfink im Lebensbaum und die trippelnde, wippende gelbe Gebirgsstelze auf dem Kiesweg zum Teich. Hier in seinem durch kein Wellengekräusel getrübten Spiegel noch einmal im Gegenbild Himmel und sommerlich langsam wanderndes Gewölk, die umgebende Grünwand der bis zur Erde belaubten Riesenbuchen und Schilf und Schwertlilien des Ufergürtels. Hier natürlich auch das still mit geschwellten Schwingen und stolz gebogenem Hals dahinsegelnde, schneeweiße Schwanenpaar, im glasklaren Wasser deutlich sichtbar die graublauen, flossenwedelnden, breitbuckligen Karpfen und der wimmelnde Karauschen-schwarm, und zu alltäglichem Besuch vom Ückleybach, mit schrillem Pfiff sich ankündend, der Eisvogel, König des gleißenden Prunks, Smaragd, Rubin und Türkis in ein Geschmeide gefaßt.
Hinter dem Weiher aber, wo die hochsteilende Buchenwand sich wie ein breites Tor öffnete und den Blick auf die Wildgatterwiese freigab, ästen brandrot, braungefleckt und lackschwarz auf grasgrünem Grund Rot- und Damwild und weideten silbrigschimmernd die Graugänse. Das Trompeten des ewig wachsamen Ganters, das Schnattern der Stockentenschar, zusammengeklumpt auf besonnter Uferböschung, das lustige Lärmen des über den Buchenkronen kreisenden Dohlenschwarmes, Hohl-taubergebuhl und der Kleinvogelsingsang mischten sich mit den heimseligen Lauten des nahen Hofs, mit dem Amboßgeläut aus der Schmiede, Hammerschlag und Sägengesumm aus der Stellmacherwerkstatt, mit Räderrollen und Huf geklapper, behaglichem Brummen der Kühe, mit Schafgeplärre und Schweingequiek und Spektakeln des Federviehs.
Alles Getier, ob in Stallung, Koppel, Gehege oder Wildbahn, gehörte zum Alltag, zum gleichen geliebten Lebenskreis. Doch die Rehe draußen im weiten Revier behielten ihren Vorrang in meinem Herzen. Sie gehörten in der Tat zum täglichen Umgang, fast wie Pferd und Hund.
Das Jahr des Landwirtes hatte keinen Anfang und kein Ende, kannte nur Flut und Ebbe, die ewigen Gezeiten der steigenden und fallenden Sonnenkraft. Saat und Ernte, Ernte und Saat waren nicht zeitliche Gegensätze, sondern überschnitten einander in ihrem Ablauf. Auch das Jahr der Rehe verlief wie ein Fließband, das sich stets vor meinen Augen vollzog.
In allem Druck und Drang der Frühjahrsbestellung und ihrer Vorbereitung, wenn man kaum wußte, wohin man sich zuerst wenden sollte, wo man am meisten gebraucht würde, so viel Zeit war immer noch, um zu diesem oder jenem Roggenschlag herüberzureiten oder -zufahren. Dort und vornehmlich, wo Winterwicke beigesät war, fand man zu jeder Tagesstunde verläßlich den hier beheimateten Sprung. Die Felder waren groß, jeder Störung durch die werkenden Menschen und Maschinen konnte dieser leicht ausweichen, auch dem lästig empfundenen Wind, denn Hänge und Gründe boten Schutz gegen ihn. Unter den Lerchenliedern ästen still oder ruhten die grauen Rehe auf dem saatgrünen Teppich, noch zu Großsprüngen vereint, zu zwanzig, zu dreißig oder gar zu vierzig Stück. Meist konnte man ihre Kopfzahl schon im voraus nennen, so oft hatte man sie gezählt, so selten trat eine Wandlung durch Zu- oder Abwechseln ein. Waren sie in Bewegung, konnte man - ließ man sich nur genügend Zeit hierfür - ihre Auflösung in einzelne Sippen und Familien erkennen. Auch für das Alter der prahlenden Bastböcke gab es dabei schon manchen Aufschluß. Begegneten sie sich, oder gerieten sie einander zu nahe auf die Decke, so behauptete sich der eine, wich der andere aus, und beide verrieten still und kampflos, auf welche Stufe der Rangordnung sie standen.
Später waren es dann die ergrünenden Wiesen, auf denen man noch seine "Herde hüten" konnte, aber nur noch für eine kurze Weile. Die Feldarbeiten wurden nicht weniger, doch die Tage länger, und sie gaben nun schon Licht genug, sich nach Feierabend "hauptamtlich" um die Rehe zu kümmern. Die Zeit des Pürschenfahrens war nun gekommen, lange bevor noch die Jagdzeit aufging. Muskelmüde vom langen Tagewerk, beglückt über den Schritt voran, den es gebracht, in jener gelösten Stimmung, die der sich herniedersenkende Abendfriede uns schenkt, saß man - zumeist in lieber, immer in sachverständiger Begleitung - bequem im Fond des Wagens, vor sich Büchse und Flinte, griffbereit auf lederbezogenen Haken liegend. Mit wiegenden Köpfen und spielenden Ohren trabten die Füchse, gezügelt von Heinrich, seit Kindesgedenken schon König vom Kutscherbock, wie weiland dessen Vater sein Leben lang. Zunächst voraustollend, dann gemächlicher hinterdrein trottend folgte "Räuber", der Langhaar, Schrecken aller streunenden Katzen und Plage aller Igel, die er kurzerhand apportierte und nur widerwillig ausließ, wenn man seinen stacheligen Ballast, oft schon weit vom Fundort entfernt, bemerkte. Abendgeläut, Heimkehr der letzten Gespanne, der mehrhundertköpfigen Schafherde, vom hechelnden Pommernpudel an den Wegrain gedrängt, der goldgelben Güsselscharen, vom zischenden Ganter umschützt, so fuhren wir gegen den Strom. Die Felder leerten sich von Mensch und Maschine, und sie füllten sich dafür mit dem Wild.
Zunächst nur zögernd, und darum ging die Fahrt meist erst im Schritt durch den Wald. Nicht als "Holzboden" oder "Bestände" betrachtete man ihn, sondern als Vermächtnis der ihn pflegenden Vorfahren, als immergrüne Familiengeschichte, als schönstes Geschenk des Schöpfers, als Heiligtum. Und nun zeigte er schon viele Spuren eigenen Schaffens. Kulturen und Schonungen, die Jahr für Jahr höher hinauf und tiefer hinein ins Herz wuchsen. Hier hielten wir Ausschau nach den Neubürgern, nach dem Damwild, das noch in festgefügten Rudeln zusammenstand und mit seinen rotbraungetüpfelten, lackschwarzen oder gar einigen weißen Decken die Parklandschaft wundersam belebte. Und nach den schneckenbewehrten Muffelwiddern und den jetzt schäbig bepelzten Mutterschafen, die schon im April - manchmal noch im verschneiten Gehölz - gesetzt hatten. Aufs neue willkommen geheißen bei jedem Anblick, aber der Vorrang blieb dennoch den Rehen.
Nicht mehr in Sprüngen vereint, hatten sie sich nun über die ganze Fläche verstreut, die Altricken, um stille Winkel zum Setzen zu finden, die von ihnen verstoßenen Spießer und Schmalrehe, um Duldung und Gesellschaft beieinander zu suchen, die Böcke, um ihre Sommereinstände zu erkämpfen und zu behaupten. Immer öfter mußten wir anhalten, in immer kürzeren Pausen das Doppelglas zu Rate ziehen. Offenbarte sich doch in diesen Wochen, was später bei aller Geduld und Erfahrung nicht mehr nachzuholen war, das Erkennen des Alters: Je früher der Bock verfegt hat, je höher steht er bekanntlich in der Rangordnung der Jahre. Beim Verfärben ist es umgekehrt, der gesunde Jährling tut es zuerst, die späteren Jahrgänge lassen sich länger Zeit.
Viele Böcke verfolgten wir Jahr für Jahr beim Aufbau ihres Gehörnes, ebensoviele narrten uns, indem sie sich sprunghaft verbesserten oder verschlechterten, so daß wir sie nicht wiedererkannten und für Wechselwild hielten. Dieses war aber äußerst selten und gewiß auch dann nur über die nahe Grenze getreten. Große Standorttreue war die Regel, sie schuf Schläge und Sippen, die bei aller Vielfalt des Hauptschmuckes vorzugsweise die gleichen örtlich festliegenden Urtypen zeitigten: die sehr enggestellten, langen und grobgeperlten Stangen des "Rollberges" und der "Rotphülen", die geraden und weitgewinkelten, auffallend hellen des "Dollenortes", die korbförmig gewölbten, sauber vereckten des Wilhelmsdorfer Waldes und die gotisch geschwungenen, tief nußbraunen des "Hohenmoores". Natürlich gab es auch alle denkbaren Zwischenstufen, die aber doch verrieten oder wenigstens andeuteten, welche der Sippen den Hauptanteil am Erscheinungsbild beigesteuert hatte. Alle Böcke, die im guten oder schlechten Sinne aus der Masse des noch ungeprägten Nachwuchses herausragten, erhielten selbstverständlich Namen, die danach beim Pürschrapport viele Worte ersparten, Namen, die sich auf Eigenheiten im Aussehen oder Verhalten, häufig aber auch einfach auf Beruf oder Dienstgrad jener bezogen, die sie ein- oder mehrmals elegant vorbeigesengt hatten.
Im Verlauf des Frühjahres wurden der Rätsel immer weniger, ging das Ansprechen immer schneller vonstatten, und kaum hatte man das Glas an den Augen, erfolgte oft schon das Kommando "Weiter!" Umschwebt vom herben Ruch der dampfenden Pferde lauschte man wieder dem lieben leisen Lied der Pürschfahrt, dem Schleifen und Mahlen der gummibereiften Räder, dem dumpfen Pochen der Hufe, dem hellen Anschlag der Eisen an Gestein, dem Schnauben und Prusten, dem Lederknirschen und Klingeln der Trensenringe. Und man lauschte dem Abendchoral, der immer voller, vielstimmiger und jubilierender aufklang. Waren es zunächst neben dem Kleinvogelsingsang nur das Heulen des Hohltaubers, das Buhlen des Ringlers, die auf- und abschwellenden Bässe der Bekassinen und die klagenden Rufe der Kiebitze im Moor, so fanden sich laufend neue Musikanten ein. Vom See herüber schwang das kehlige Kollern der Haubentaucher und das lustige Spotten der Rohrdrosseln, in den Wiesen schnarrte der Wachtelkönig, aus dem Ufergebüsch des Ückleybaches stieg schmelzend des Sprossers bittersüßseliges Solo, und dann überall in Wald und Feldgehölz hallte und schallte der alljährlich am sehnlichsten erwartete Ruf des den Maiensommer einläutenden Kuckucks. Doch erst mit dem Flöten und Niesen des Pirols im grünseidenen Buchengewölbe war das Orchester vollständig, die große lenzliche Heimkehr beendet.
Gleich der Abendhymne gehörte zu solcher Pürschfahrt auch die im Schummern einsetzende kleine Nachtmusik: die leiernden Chöre der Frösche, die dunklen Glocken der Unken, das Juhlen und Schilpen der Käuze, das Silberklingeln ziehender Enten und das Schrecken der Rehe irgendwo in nebelnder Wiesenweite.
Die Welt wurde schöner von Tag zu Tag, des Grünens und Blühens wollte kein Ende finden, und immer neue Wohlgerüche erfüllten balsamisch die Luft, bitterschwer und berauschend der Faulbaum, frisch wie Ozon der schossende Roggen, heimselig duftend der rosig schimmernde Klee, das gelblodernde Lupinenfeld, das erste welkende Wiesenheu und an dem schon ein wenig schwermütigen Ende des Duftsommers der honigsüße Ruch der bienenumsummten Linden.
Längst waren die Böcke sauber verfegt und sommerrot, aber der eine oder andere war schon unverfärbt gefallen. Nicht waidgerecht? Nun, wie anders hätte man den hohen Abschuß, den befohlenen und peinlich befolgten Wahlabschuß erfüllen können, so fleißig Berufsjäger, Freunde und Jagdgäste auch mithalfen, die Zeit zu nutzen, bevor das feistfaule Rehwild sich in der Unendlichkeit des Halmenmeeres allen Blicken entzog? Wenn ich anderswo schrieb, daß die Rehe für uns östliche Landwirtsjäger zum täglichen Umgang gehörten, so muß ich doch die Wochen etwa zwischen Mitte Juni und Mitte Juli, freilich als die einzigen des ganzen Jahres, ausschließen. Da konnte man schon beim ersten Hahnenschrei draußen sein, in der stillen Mittagsstunde Umschau halten, abends bis zum völligen Eindunkeln herumkutschieren, man bekam, wenn man sehr viel Glück hatte, mal am Roggenrand oder kniehoch vergrasten Grabenrain einen brandroten Rücken, ein Haupt mit spielenden Lauschern, einen wegtauchenden Spiegel, meist aber gar nichts zu sehen. Wie ausgestorben war das Revier, und jeder, der es nicht besser wußte, hätte es für absolut "rehrein" gehalten. Warum aber hätte es anders sein sollen? Kraut, Blatt und Gras draußen im vollen Licht waren fest und hart geworden, der eingesäte Klee und die Serradella im Halbschatten des Halmenwaldes zart und süß geblieben. Das Rehwild konnte sie fast vom Bett aus äsen und hatte zudem volle Deckung und Schutz vor Mücken und Fliegengeschmeiß.
Dann aber über Nacht und wie von einem Zauberstab berührt, wandelte sich das Bild vollkommen, standen auf jedem Weg, jeder Drift, jeder Schneise frisch die gespreizten Fluchtfährten, wimmelte unsere grüne Welt von roten Pärchen in bewegtem Hexenring und Hochzeitsreigen, und wo man eine einzelne Ricke sah, konnte man sicher sein, bald auch den dazugehörigen Bock nahebei ermattet im Bett zu entdecken.
Erntesommer, sattgrün allein noch die Hackfruchtfelder und nachwachsenden Wiesen, Inseln nur im goldgelben Meer des reifen Getreides, in das sich nun Stück um Stück Maschinenmesser und Sense hineinfraßen. Erste Stiegen auf Stoppeln, hochwillkommene Jagdgründe des aufgeblockten Bussards, des rüttelnden Turmfalken, des Frösche sammelnden Storches. Erntezeit, Sorgenzeit: Aufwand, Einsatz, Fleiß und Schweiß eines ganzen Jahres standen nun in tausend, hunderttausend Garbenzelten als leicht verderbliche Frucht unter dem freien Himmel, wie würde man all* diesen Segen rechtzeitig bergen können! Ungezählte bange Blicke wendeten sich zum westlichen Wetterwinkel, zum ständig auf unbeständig stehenden Wetterglas. Wie oft Gewitter und rauschender Regen, wenn gerade die ersten hochbeladenen Fuder scheunenwärts heranschwankten, wie oft die schicksalsergebene Dienstanweisung für den Rest des Tages: "Wagen kurz machen, Dung fahren!" Und wie oft danach der prüfende Griff in die Ährenkrone, in das Bund, in das Bolzende und Beratung mit Inspektor und Hofmeister, ob und wann das Einfahren wieder beginnen könne, oder auch die schwerwiegende Entscheidung, was vordringlicher sei, die trockenen Garben zu bergen oder die noch auf dem Halm stehende hochreife Frucht vor Streuverlusten zu schneiden und aufzusetzen! Wir haben es aber doch immer geschafft, auch damals, als es noch keine Mähdrescher gab.
Erntezeit nun auch für die Böcke, die fehlerlosen, die man als reif ansah für die erntende Büchse, meist aufgespart für die lieben Jagdgäste, die Sommer für Sommer verläßlich wie die Schwalben wiederkehrten. Kutscher Heinrich brauchte nun nur an- und auszuspannen, für ihn war kein Platz mehr frei, auf dem Bock thronte meine Frau, vollendete Meisterin in der Kunst des Pürschenfahrens. Dem Gast diente ein solches Unternehmen nur ausnahmsweise zum Schuß, in der Regel nur zum Schauen, zum Überblick. Wir zeigten ihm nach Möglichkeit viele Böcke, er aber sollte nach eigenem Geschmack die Wahl treffen, sich in einen der Braven "verlieben". Hatte er sich entschieden, sollte es ernst werden, wurde er für Pürsch und Ansitz sich selbst, seiner Geschicklichkeit und seinem Glück, seinem Hoffen und Bangen überlassen. Wußte ich doch zu genau, daß eigenes Planen, selbständige Entschlüsse und ihre von jeder Gängelei freie Durchführung den Wert einer solchermaßen erdienten und verdienten Rehkrone bestimmten, nicht aber der saubere Schuß allein.
Am Ernten der jagdbaren Böcke beteiligte ich mich selbst längst nicht in jedem Sommer und mit den Jahren immer seltener. Nicht etwa edelmütiger Verzicht zugunsten der Jagdgäste oder gar Blasiertheit und Überdruß hemmten mich, sondern ganz einfach die Tatsache, daß ich dank der täglichen "Tuchfühlung" die heimatlichen Böcke, ihre Gewohnheiten und Wechsel so genau kannte, daß es keinerlei jägerischen Könnens mehr bedurfte, sie auf die Decke zu legen. Mich reizte eine andere, nie völlig erlernte, immer Stückwerk gebliebene Kunst: das fehlerfreie Ansprechen und Erlegen jener Böcke, deren Gehörne nie über das Mittelmaß hinauskamen, die Jugend und Zukunft vortäuschten, während ihre Träger in Wirklichkeit schon längst der ausmerzenden Büchse hätten verfallen müssen. Schon damals war ich darüber hinaus, in ihnen "Artverderber" zu sehen, vielmehr davon überzeugt, daß die Mängel, die sie aufwiesen, in der Regel durch Ungunst der Umwelteinflüsse bedingt, nicht ererbt und also auch nicht weiter vererbbar waren. Dennoch war ich tief befriedigt, wenn ich an einen solchen, mit mehr Mut als sicherem Wissen gestreckten Bock herantrat, und wenn ein dürftiges, auf dünnen, aber schon tiefabgewetzten Rosenstöcken stehendes Stangenpaar und der Zahnabschliff die letzten Zweifel behoben, daß hier mit Recht ein Bock ohne Zukunft den Lebensraum für einen anderen erhaltungswürdigen freigemacht hatte.
In der Frühe aber pürschte ich meist zu Fuß oder vom abgestellten Kraftrad aus, so die große Morgenfeier des werdenden jungen Tages voll auskostend, jene immer aufs neue tief ergreifende Stimmung, die niemals treffender beschrieben wurde, als mit jenem bekannten Vers: "Frühmorgens auf seine Weise still und leise wandelt der liebe Herrgott durch den Wald." Nebel über den Wiesen, ziehender Weihrauch zwischen den silbernen Buchenstämmen, Kleinvogelgejubel, demgegenüber der Singsang nach Sonnenaufgang nur noch ein Lallen bedeutet, rosig entflammendes Gewölk am türkisblauen Himmel, noch unberührt die Keuschheit der Schöpfung, und noch kein Mensch weit und breit, als allein der pürschende Jäger. Daß ich diese Herrlichkeit vielhundertfach erleben durfte, diese Stunden nicht in nachtdumpfer Bettstatt vergeudete, verdankte ich allein den roten, sich still in Tau und Dunst äsenden Rehen.
Diese verloren auch nichts an Bedeutung und tagtäglicher Beachtung, wenn es Herbst wurde, die Hühnersuche in den Hackfruchtschlägen, der abendliche Enteneinfall auf den Teichen und Feldtümpeln, schließlich der erregende, stimmungsträchtige Gänsestrich am Querrnsee übermächtig lockten, und wenn zu allem Überfluß noch die ersten Jagdeinladungen auf Rotwild und Sauen auf dem Schreibtisch landeten. Hauptereignis der Hühnersuche war nicht selten, daß der bedächtig revierende Langhaar "Räuber" einen lange vermißten, schon totgeglaubten Bock aus dem bis ans Knie reichenden Kartoffelkraut hochmachte, und auf die klingelnd heranziehenden Enten unterblieb wohl der Schuß, wenn gerade Rehwild nahebei vorüberzog. Allein die Jagd auf Gänse hatte absoluten Vorrang, wenn Sturm oder Nebel sie zum tiefen, für die Schrote erreichbaren Streichen herniederzwang.
Herbstzeit brachte noch einmal Hochdruck der Arbeit und Mühsal und Sorgen die Hülle und Fülle. Hackfrüchte auf mehr als 700 Morgen wollten bei ständig abnehmenden Tagen und sich verschlechternder Witterung gerodet, gesammelt, geborgen und winterfest eingemietet werden, bevor der erste unberechenbare Frost einsetzte, und auf ebensovielen Morgen wollte zugleich das Winterkorn in sauber bereitetes Saatbett gedrillt werden. Jetzt hieß es, die Stunden für die lieben Rehe buchstäblich zu stehlen, galt mir doch der Wahlabschuß der Ricken noch wichtiger als der der Böcke. Auch sie hatten die sich zeigenden Mängel freilich durch Umwelteinflüsse erworben, also in der Regel nicht ererbt, sie aber würden diese an die künftigen Generationen weitergeben, da von einem geschwächten Organismus und einem kümmerlich fließenden Milchquell nur eine geschwächte Nachzucht zu erwarten ist. Hätten mich nicht Freund Jochen Melms, zugleich Fischmeister, und der goldtreue Jäger Eduard Reich ebenso sachverständig wie passioniert unterstützt, ich allein hätte das schwere und durchaus nicht immer erfreuliche Werk niemals geschafft, vor allem nicht während der hochwichtigen Verfärbungswochen, in denen die alten, die uralten Ricken an dem weit über die normale Zeit hinaus getragenen roten Rock leicht und verläßlich als solche anzusprechen waren.
Dann aber kamen wieder friedlichere Zeiten, der Außendienst wurde mehr und mehr zum Innendienst. Die Maschinen der Brennerei und Flockenfabrik stampften, Rauchwolken wälzten sich aus dem hochragenden Schornstein, säuerlich roch es nach Maische, Silage und Rübenblatt, und das vielstimmige behagliche Brummen, Blöken und Rüffeln der Rinder, Schafe und Schweine und das klirrende Wiehern der fröhlichen Fohlenschar übertönte nun ein neuer Klang: das Schnattern und Trompeten der großen Gänseherde, die sich, im offenen Verschlag bis zum Platzen prassend, der uns willkommenen Wandlung in Festbraten und Spickbrust entgegenmästete. Die auf- und abschwellenden Bässe der Dreschmaschine, das Kreischen der Kreissäge und der immer öfter aufklagende Todesschrei eines schlachtreifen Borstenviehs bestimmten das pommersche Winterlied.
Nebel brauten, Regen rann oder rieselte, die Räder der mit dampfendem Dung beladenen Wagen verwandelten die Wege in tiefen Schlamm, aber dies hinderte mich nicht, täglich hinauszufahren, um mit Glas und Büchse bewaffnet letzte Heerschau unter dem Rehwild zu halten und es zugleich mit Kleeheubündel und Kraftfuttersack von den frischgrünenden Saaten fort an die ständigen Fütterungen zu locken. Längst war es dann an diese gewöhnt, wenn der richtige Winter mit Frost und Schnee einbrach. Nun war es der Schlitten, mit dem uns die braven, schellenbehan-genen Fuchsstuten durch Wald, Feld und Wiesen zogen, und wie beglük-kend war solche Fahrt, wenn das Wild uns schon erwartete und vertraut an die rohrgedeckten Futterhäuschen herantrat, kaum daß wir diese gefüllt und unser Gefährt wieder gewendet hatten! Noch vieles andere gehörte zu solcher behaglichen Hegefahrt: die um die Schüttung herumlungernden Fasanen, die braunen, in den Schnee gekuschelten, stets sorgenvoll gezählten Bällchen des Rebhuhnvolkes nahe seiner Fütterung an der Schlehenhecke, der auf dem Kleeschlag mausende Fuchs und der auf den hohen Chausseebäumen aufgeblockte Rauhfußbussard, der anscheinend genau wußte, wie weit eine Schrotflinte trägt. Aber die Rehe blieben immer die Hauptsache, das "Hochwild des Herzens".
Auch später dann an den langen Winterabenden in wohlig durch-wärmter Stube, wenn draußen der Schneesturm tobte oder die Waldkäuze, schon den Vorfrühling im Blut, jodelten, spielten die Rehe noch immer eine gewichtige Rolle. Das Jahr des Landwirtes, ohne Anfang und Ende, verlangte in dieser Zeit der Ebbe bereits die kommende Flut, die Frühjahrsbestellung, sorgfältig zu planen und vorzubereiten. Da saß und brütete man Stunde um Stunde über der künftigen Fruchtfolge und dem Düngungsplan, trug in den Gutskarten nach, was die Bodenuntersuchungen ergeben hatten, zeichnete ein, was im letzten Sommer an Dränagen und Vorflutern, an Waldkulturen und Feldschonungen neu erstellt war, und befaßte sich schon wieder mit neuen Entwürfen, Ergänzungen und Verbesserungen. Wenn es hierbei nun die Wahl gab, welche Wiese als nächste umgebrochen und neuangesät, welches Feldgehölz mit Fichte oder Weichhölzern unterbaut, wo Raps und Landsberger Gemisch gedrillt, Klee und Serradella zwischengesät werden sollten, immer führte dann auch der Jäger die Feder und richtete sich selbstverständlich nach den Wünschen und dem Wohlgefallen - der lieben Rehe. -
So verlief Jahr um Jahr - aber es wurden ihrer allzuwenige, dann kam der Krieg, und ich war zu Hause nur noch ein Gast. Und es kam die Zeit, da auch die letzte Strophe des Gedichtes aus des Vaters Mappe sich erfüllte; viel tragischer, als es der Dichter gewiß im Sinne gehabt hatte:
"Wie eine Tochter schau ich voll Wehmut dich schon, Denkend der Stunde, da Abschied mein Lohn
Da ein Stärkerer kommt, für den du bestimmt, Und mit Herrschergefühl in die Arme dich nimmt."
Sommer 1944, schon war der "Stärkere" in unaufhaltsamem Vormarsch begriffen, die eigene Front trotz verzweifelter Abwehr ins Weichen geraten. Für den, der nicht die Augen verschließen wollte, zeichnete sich bereits die künftige Katastrophe ab. Ihre tiefen Schatten breiteten sich schon über meinen Urlaub von der Ostfront, über das letzte, allerletzte Waidwerk auf den roten Bock der Heimat.
Kein Wunder, daß ich es in dieser Stimmung lustlos unternahm, mich überhaupt nur dazu entschloß, um unserem damals zwölfjährigen, aber schon jagdpassionierten Sohn ein solches Ersterlebnis an des Vaters Seite zu verschaffen. In den Wiesen am Westufer des Querrnsees, dort, wo in jedem Sommer das einzige Heidelerchenpaar mich mit seinem tremulierenden Dudeln immer an Hermann Löns und sein "Braunes Buch" erinnerte, stand damals der beste, seit Jahren bekannte Bock des Reviers. Ihm sollte es gelten. Da Blattzeit war und damals im Zeichen der Ackerpferde, die über Mittag im Stall mit Hafer und Häcksel versorgt werden mußten, um diese Tageszeit in den Feldern noch Pans Friede zu herrschen pflegte, fuhren wir gegen 12 Uhr los, dann verlief alles schneller, als es mir lieb war, ohne Spannung, ohne Stimmung, ohne Höhepunkte und Poesie.
Während ich mit den Augen noch die nachwachsenden Grummetwiesen absuchte, entdeckte Kutscher Heinrich vom hohen Bock herab das treibende Paar in einem Kartoffelschlag. Es war zu sehr mit sich beschäftigt, zu sehr dem blutheißen Trieb hingegeben, um dem im Schritt sich nahenden und schließlich haltenden Wagen Beachtung zu schenken. Auch ohne Glas erkannte ich den Bock an seinem hohen, weitausgelegten und sauber vereckten Gehörn sogleich wieder. Ein oder zwei Jahre sollte man ihm noch schenken, dachte ich und verfiel noch einmal in Unschlüssigkeit. Da streifte mein Blick die fiebernden Augen des geliebten Jungen, ich griff zur Büchse. Mechanisch, ohne daß es mir wie sonst siedend in die Adern schoß, setzte ich dem roten Hochzeiter die Kugel aufs Blatt. Nach wenigen taumelnden Fluchten versank er im grünen Kraut.
Sobald die zunächst fassungslos verhoffende und zurückäugende Ricke außer Sicht war, schickte ich den Jungen voraus. Er sollte den Bock finden, sich als erster an dem Anblick des Gestreckten weiden, vielleicht daß sich diese Minuten fest in sein junges und noch empfängliches Herz einprägen würden. Ohne seine Gegenwart wäre dieser Schuß jedenfalls unterblieben. Natürlich sagte ich es ihm nicht und ließ es mir auch nicht anmerken, daß sich meine Freude allein an der seinen entzündete.
Später in der Rückschau aber habe ich dann diesem ohne innere Anteilnahme und lustlos ausgelöschten Bock doch den ihm als Abschiedsgeschenk der Heimat gebührenden Ehrenplatz in meiner Erinnerung dankbar eingeräumt. -
Warum ich dies erzählte, warum ich überhaupt das Jahr des pommer-schen Landwirtes, das zugleich ein Jahr der heimischen Rehe war, kurz skizziert, an den Anfang dieser Geschichte setzte? Ich glaubte, den vielen Freunden und freundlichen Jagdherren, die mich später im Exil auf den roten Bock einluden, eine Erklärung schuldig zu sein, weshalb ich ihr gutgemeintes Anerbieten stets abschlug: In der Schatzkammer meiner Erinnerungen bleibt das Rehwild als "Hochwild des Herzens" untrennbar mit der Heimat verbunden. Mir würde es eine Verwässerung, Verflachung, ja Entweihung bedeuten, würde ich auf dieses Wild in fremden Revieren wieder zu waidwerken anfangen. Man mag mich wunderlich und kauzig schelten, aber man verzeihe mir, ich kann nicht anders.
Deshalb nahm ich auch nicht als Jäger, sondern nur als Jagdbegleiter -einundzwanzig Jahre danach - an einer Fahrt zur Rehbockpürsch teil, an einer zuweilen gespensterhaft anmutenden, an Rückblicken und inneren Gesichten überreichen Reise gen Ostland wohl über die Heid'. In zahllosen, immer wiederkehrenden und sich im Gehalt nur wenig unterscheidenden Träumen hatte ich diese Reise freilich schon lange vor der Morgenfrühe jenes 20. Maies angetreten. Wohl überdeckt von den Erinnerungen an meine Fußwanderung nach dem Zusammenbruch von der Tscheche! bis Holstein, um russischer Kriegsgefangenschaft zu entgehen, unternahm ich auch jede dieser Traumreisen zu Fuß, entging ich auch hier durch jägerische Gewandtheit, jede Deckung nutzend, schleichend und immerfort sichernd allen Verfolgern und erreichte stets das Ziel: Heimat, Hof und Haus. Hier aber verwandelte ich mich offenbar in einen Geist, denn ich wanderte frei auf vertrauten Pfaden, schritt durch die lieben alten Räume, mitten zwischen den tafelnden Polen hindurch, aber niemand gewahrte mich oder wehrte mir. Diese Träume, ständig im Halbschlaf nachgenossen und im Tagesablauf nachleuchtend, wurden mir mehr und mehr zu einem Anruf, einem Ruf der Heimat, und immer gewisser wurde mir, daß ich ihm eines Tages folgen mußte. Folgen mußte, obwohl ich mir völlig klar darüber war, daß der Weg nicht mehr zum Paradies zurückführen, nur noch einem Gang an die Gruft der Geliebten gleichen konnte.
Inzwischen war der eiserne, West und Ost trennende Vorhang, den ich so oft träumend durchwandert hatte, auch von dem scheinbar noch härteren Dollar durchlöchert worden. Die Jagdtouristik in Devisenreviere - Wortungeheuer unserer entgötterten, an Geist und Gemüt schwindsüchtigen Zeit - hatte das Tor auf gestoßen, aber zunächst noch verdammte man jene Jäger, die tatendurstig hindurchschritten, und geißelte ihr Waidwerk drüben unter Sichel, Hammer und Sowjetstern. Ich habe diesen Standpunkt niemals geteilt. Die Devise: Erhaltet und pflegt die östlichen Jagdgründe mit ihren unersetzlichen Wildschätzen! erschien mir immer jene Devisen zu rechtfertigen, die doch nur einen Bruchteil der im Rahmen erwünschter und getätigter Handelsverträge Herüberfließenden darstellen, und darüber hinaus versprach ich mir viel von der heilsamen völkerversöhnenden Kraft des Waidwerks, auch wenn sie zunächst nur in wenigen Keimzellen zu wirken vermag. Allein darauf schien und scheint es mir anzukommen, daß nicht die "armen" reichen Snobs, sondern würdige Vertreter deutschen Jagens die Brücken zu den benachbarten, altbewährten Jägernationen schlagen. Und wer will schließlich den Stein auf jene werfen, denen die grausam geschrumpfte Heimat keinen Raum mehr bietet, die Büchse zu führen! -
So waren es auch rund fünfzig Kraftwagen, gefüllt mit grüngewande-ten Gestalten, die in der Frühe des letzten Schontages des roten Bockes die Zonengrenze bei Helmstedt passierten. Und hier schon begann das Gespenstige unserer Reise: Die Wegschilder mit den vertrauten Namen, die lieben alten feldgrauen Uniformen und Rangabzeichen, doch die, die sie trugen, schienen Fremde zu sein, die den Fremden korrekt, aber kalt abfertigten. Zuweilen nur erkannte mein fragender Blick im Auge des anderen ein brüderliches Aufglimmen, doch es erlosch, sobald sich ein Vorgesetzter näherte. Die strenge Kontrolle des Waffenpasses und der Waffen, der fahrbare Spiegel, der unseren Wagen unterwärts abtastete, der Prüfstab, der in unseren Tank eintauchte und anderes mehr, zeigte uns, daß wir die trennendste Grenze der Welt, jene der Weltanschauungen überschritten hatten. Es schnitt ins Herz, denn drüben am Ostende der Frankfurter Oderbrücke, im Reich des weißen Adlers, war die Abfertigung weniger umständlich, der Empfang wärmer, ja herzlicher. Dann am frühen Nachmittag, nach Aufteilung der einzelnen Jägergruppen und begleitet von unserem nun ständigen, stets frischfröhlichen und gefälligen Betreuer der Orbis, der polnischen Reisegesellschaft, begann das große Abenteuer des Wiedersehens, nicht mit der Heimat, aber doch mit der heimatlichen Landschaft.
Mein Lieblings- und Patenneffe Bogi, trotz junger Jahre schon weitgereist, welterfahren und erst kürzlich für eine Weile aus Guatemala zurückgekehrt, staunte am Steuer seines Volkswagens. Daß es dies noch gab: Alte, aber noch nicht von den rasend rotierenden Reifen schwerer Laster und schneller Pkws zerlöcherte Chausseen, leere Straßen, auf denen man nach Herzenslust Gas geben konnte, und selten nur bespannte Fahrzeuge und Pferde, die noch vor dem Auto scheuten! Eine völlig andere Welt, um Jahrzehnte zurückgeblieben! Schneller als gedacht kamen wir voran, Friedeberg, Woldenburg, Schloppe, und dann kurz hinter Schneidemühl gab es den ersten Halt.
Und den ersten heißen Stich ins Herz hinein: Borkendorf, meines Neffen Geburtsstätte, seine und seiner Geschwister Kindheitsparadies. Wie eh und je strömte die schnelle und fischreiche Küddow durch ihr gewundenes Bett, unversehrt bollwerkte der alte Park im Schmuck seines maigrünsei-denen, vom Kupfer der Blutbuchen durchbrochenen Kronengewölbes. Das alte Schloß, von meinem Schwager wegen Unwohnsamkeit als Speicher vermietet, war bis auf die Fundamente abgetragen, und dies war das einzige was hier geschehen war, einundzwanzig Jahre danach. Die Hofgebäude verlassen, verödet, zerstört, so wie sie die Feuerwalze des russischen Angriffs auf Schneidemühl hinterlassen hatte. Auch das schmucke kleine Gutshaus lag in Trümmern, Heimstatt nur noch dem Storchenpaar, das auf dem inmitten zusammengestürzten Dachgebälkes aufragenden Schornstein horstete. Allein die alte sperrige Fliederhecke, über und über voll violettblühender Dolden, schien hier das ewige Leben zu haben.
Schweigsamer setzten wir unsere Fahrt fort, nun auf den mir so sehr vertrauten, meist von Birken umsäumten, nun seltsam schmal wirkenden Landstraßen, deren Hälfte noch dazu von alters her als Sommerweg -zur Schonung der Pferdebeine - unbefestigt war. Auch die Telefon- und Lichtmasten stammten noch aus "unserer" Zeit, zwar war ihr Fuß inzwischen verfault, aber man hatte sich zu helfen gewußt, indem man die Stangen je zwischen zwei eingelassene Zementsockel verankert hatte. Regenschauer prasselten gegen die Scheiben, wie frisch gewaschen wirkte die maigrüne Landschaft, prahlten die Saatfelder, dampften die braunen Äcker. Dazwischen weiteten sich noch winterlich fahle Wiesen, ergrünende oder knospende Wälder, stille verträumte Seen und im unaufhörlichen Wechsel wieder Seen, Felder, Wälder und Wiesen. Jastrow, Landek, Schlo-chau, Konitz, Tuchel ließ unser mit Vollgas jagender und selten nur durch Gegenverkehr behinderter VW wie im Fluge hinter sich zurück, dann bogen wir nach Süden ab und erreichten in etwa einer Stunde kurz vor dem Eindunkeln unser Ziel.
In Kamieneci, einst Kamnitz, stieg unser Betreuer aus, uns anzumelden. Lange ließ er uns warten. Kein Wunder, daß unser Gastgeber wohl möglichst genau wissen wollte, wes Geistes Kinder wir waren. Mein Himmel, Menschen aus dem weltfernen, goldenen, aber gefährlich undurchsichtigen Westen, fast so fremd wie Marsmenschen, was war von ihnen zu erwarten, wie sollte man sie empfangen? Und Junker dazu, preußische Junker, Abschaum der Menschheit, wenn man der Sprachregelung trauen wollte!
Wir besahen uns derweilen von außen das Schloß, einen bernsteinbraunen, schlichten, doch durch Wucht und Maße edel und vornehm wirkenden Bau. Lange verhielt ich an dem von einer mächtigen Linde überschatteten Vorbau des Kücheneingangs und sah hier im Geist die Jäger vergangener Generationen nach erfolgreicher Pürsch sitzen und die Rosen starker Rehkronen und die blinkende Schädelstirn aus der heißen, dampfenden Schwarte schälen, hingegeben dieser stimmungsträchtigen, nachgenießenden Zeremonie oder, besser gesagt, rituellen Handlung.
So versunken war ich in diese Visionen, daß ich die Rückkehr unseres Betreuers erst bemerkte, als er uns mit dem Gastgeber bekanntmachte. Dieser geleitete uns ins Schloß und durch die Halle ins obere Stockwerk hinauf und wies uns unsere Zimmer an, sachlich modern eingerichtete Einzelzimmer mit Schlafcouch und Duschraum. Gewiß eine Konzession an die verwöhnten Gäste des Westens, aber ich war irgendwie ernüchtert, hatte ich doch das vertraute Fluidum altehrwürdiger ländlicher Logierzimmer mit ihrem Ruch nach Moder und abgestandenem Parfüm und mit ihren eingedunkelten, goldgerahmten Ölbildern an den stockfleckigen Tapeten erwartet, freilich auch die gefürchteten, prallfedergefüllten, erhitzenden, erdrückenden polnischen Betten.
Doch hier wie in allen übrigen Räumen des Schlosses wehte kein Hauch mehr vom Geiste jener, die hier gewohnt und gewirtschaftet, gehaust und geherrscht hatten, und denen ich mich seit Betreten ihres hinterlassenen Paradieses in merkwürdig naher, fast magischer Weise als Standes-, Schicksals- und Leidensgenosse verbunden fühlte. In der Folge draußen die Gottnatur aber sollte sich als beständiger und dankbarer erweisen, und hier traf ich dann oft auf Wege und Werke der vorangegangenen Grundherren, die gewiß auch in dem Gut das irdische Paradies, die Geliebte, gesehen und sie zu verjüngen und zu verschönen als Lebensauftrag befolgt hatten. So manchesmal, wenn ich dann später die altehrwürdige Freitreppe hinabschritt, überfielen mich wieder Visionen, sah ich im Geist anno 1919 den Grafen Königsmark mitsamt den Seinen - Abschied der Lohn - diesen Gang ein letztesmal tun, alle Herrlichkeit dieser gottgesegneten Heimat hinter sich lassend, weil er für Deutschland optiert hatte, und sah ich im gleichen Mitgefühl genau zwei Jahrzehnte darauf den Nachfolger, einen polnischen Edelmann, den gleichen bitteren Gang hinaus aus dem liebend umworbenen Landsitz tun, um für sein Vaterland zu kämpfen und zu fallen. Kamieneci, einst Kamnitz, aber war für den "Stärkeren", der dann kam, nicht bestimmt, es folgte ein mehr Nutzenbringender, ja, und nun war diese Perle der Tucheier Heide - ein Devisenrevier für die Jagdtouristik. Für mich, mein Gemüt, mein Grübeln war es unendlich viel mehr, denn mich begleiteten in den nächsten Tagen Gespenster und Gesichte auf Schritt und Tritt, und so sah ich hinter dem Gegenwärtigen immer auch das Vergangene, hinter dem fremden Schicksal auch das eigene.
Doch zurück zu unserem Einstand. Unser Gastgeber lud zum brechend beladenen Abendbrottisch, und nun erst hatte ich Gelegenheit, ihn näher zu betrachten: ein Mann wie ein Eichbaum, hochgewachsen und schwer und füllig, niedrig auf den überbreiten Schultern thronte ein gewaltiges Haupt, nur noch schütter von angegrautem Haar bedeckt, blaue Augen, die ein wenig schwermütig dreinschauten, und unter der starken Nase und dem kleinen, kurzgestutzten Bärtchen, im Gegensatz zu allem anderen, ein weicher, genießerischer Mund. Wir speisten zu viert, die Frau Direktor, eine noch recht jung wirkende, rassige Erscheinung, überwachte nur das Anrichten und Servieren durch die extra für uns angestellte Köchin, Panje Rosalie, denn die Familie wohnte nicht im Schloß. Die betonte Höflichkeit des Majordomus von Kamieneci wirkte mehr distanzierend als erwärmend, und eine rechte Unterhaltung wollte nicht aufkommen. Mein Himmel, wie hätte es auch anders sein sollen: auf gezwungene Gäste, Fremdlinge aus dem weltweiten Westen, und gewiß auch die Auflage höheren Orts, sie nicht näher an sich herankommen zu lassen, als das Devisengeschäft es verlangte. So wenigstens war mein erster Eindruck. Bald zogen wir uns zurück.
Früh um 3.30 Uhr, nur ein Glas köstlicher sahniger Milch im Magen, brachen wir auf, dies einzigemal in dem VW meines Neffen. Der Direktor zwängte sich, um uns zu führen, auf den Sitz neben dem Fahrer. Nach kurzer Fahrt in den taugebadeten Morgen hieß er uns halten und aussteigen und pürschte uns voran, einem sumpfigen Bachtal folgend. Nur eine Viertelstunde lang beobachtete ich, wie lautlos er seine Körperfülle voranbrachte, wie er die Deckung ausnutzte, wie er sie erst verließ, nachdem er jede Blöße, jeden Winkel abgeleuchtet hatte, und schon wußte ich, wir waren an einen alterfahrenen, an einen wirklichen Jäger geraten, und war nun gewiß, daß alles gut und harmonisch verlaufen würde. [...]
|
Gibt es das Buch noch?